
Dimension 1.4 Langfristige Wirkungen
1.4.1 Die Schule schöpft ihre Möglichkeiten zur Verringerung von ungleichen Bildungschancen und Benachteiligungen aus.
Aufschließende Aussagen
- Die Schule trägt dazu bei, dass die Wahl des weiteren Bildungsweges nicht von Merkmalen wie beispielsweise sozialem Status, Zuwanderungsgeschichte, Geschlecht oder Behinderung geprägt ist.
- Die Schule trägt dazu bei, dass bei der Berufswahl geschlechtsbezogene Rollenzuschreibungen überwunden werden und eine selbstbestimmte und unabhängige Lebensführung ermöglicht wird.
- Die Schule trägt dazu bei, dass alle Schülerinnen und Schüler nach erfolgreichem Schulbesuch den Besuch einer weiterführenden Schule, eine Ausbildung, ein Studium oder eine Erwerbstätigkeit anstreben.
Erläuterungen
Es besteht ein breiter Konsens, dass der Bildungserfolg nicht durch Faktoren wie Bildungsnähe des Elternhauses, sozialer Status, Zuwanderungsgeschichte, Behinderung oder Geschlecht bestimmt sein darf. Wenn auch eine Vielzahl von Faktoren die Bildungsgerechtigkeit beeinflusst, hat Schule jedoch einen erheblichen Anteil, dass die Bildung der Schülerinnen und Schüler erfolgreich verläuft. Es muss sensibel geschaut werden, wie es der Schule gelingen kann, schulische Chancendisparitäten zu identifizieren und zu beheben.
Die hier zur Verfügung gestellten Materialien weisen auf u.a. Forschungsergebnisse zum Thema Bildungsgerechtigkeit hin. Es werden Handlungsfelder beschrieben, die dazu dienen, zentrale Ansatzpunkte zu benennen, um Bildungsbenachteiligungen zu vermeiden und abzubauen.
Hier sei ebenso auf die Materialien zur Dimension 2.4 zur „Schülerorientierung und Umgang mit Heterogenität“ sowie zur Dimension 3.2 zur „Kultur des Umgangs miteinander“ verwiesen.
Probleme oder Hinweise zu diesem Material meldenMaterialien
Material zum Download:
Handreichung
Lizenzhinweis: kein Hinweis
In diesen KMK-Empfehlungen werden Handlungsfelder beschrieben, die dazu dienen, zentrale Ansatzpunkte zu benennen, um benachteiligende Geschlechterstereotypien zu vermeiden und abzubauen. Ein Fokus liegt auf den Bereichen Unterrichtsvorgaben, Prüfungsaufgaben, Lehr- und Lernmittel, Lehramtsausbildung und -fortbildung, strukturelle Ansätze, Personalentwicklung und Sachausstattung.
Link zum Material eingesehen am: 25.01.2024Probleme oder Hinweise zu diesem Material meldenDie klassische Geschlechterkonstruktion bei Jungen und jungen Männern gerät zunehmend ins Wanken. Der Beitrag untersucht vor diesem Hintergrund, wie unterschiedlich Mädchen und Jungen tendenziell im Verlauf der Bildungsstufen des allgemeinbildenden Schulsystems abschneiden. Als eine unterstützende Maßnahme wird die Erhebung von Schülerdaten im bildungsbiografischen Längsschnitt angesehen, die weiteren Aufschluss über kumulative Effekte entlang schulischer Weichenstellungen im Bildungsverlauf bieten kann.
Link zum Material eingesehen am: 25.01.2024Probleme oder Hinweise zu diesem Material meldenDie Studie ermöglicht einen Überblick über die Zugangschancen von jungen Menschen mit Behinderung in Ausbildung und Beschäftigung. Kapitel 3 beleuchtet insbesondere die Rolle der Schulen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf.
Link zum Material eingesehen am: 26.01.2024Probleme oder Hinweise zu diesem Material meldenDer Jugend-Migrationsreport ist eine Zusammenstellung von empirischen Befunden. In den Fokus genommen werden Bildungsverläufe und -abschlüsse an Schulen, die Berufsausbildung und die akademische Ausbildung sowie die non-formale Bildung im Bereich der Jugendarbeit. Dieser Forschungsüberblick zeigt die Chancen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zur gesellschaftlichen Teilhabe und Integration auf.
Link zum Material eingesehen am: 26.01.2024Probleme oder Hinweise zu diesem Material meldenEine der Kernfragen ist: Wie kann digitales Lernen benachteiligte Lernende fördern und den Zugang zu den einzelnen Bildungssektoren insgesamt erhöhen? Link zum Material eingesehen am: 26.01.2024Probleme oder Hinweise zu diesem Material melden
1.4.2 Die von den Schülerinnen und Schülern erworbenen Kompetenzen ermöglichen ihnen weiteres erfolgreiches Lernen.
Aufschließende Aussagen
- Die Schülerinnen und Schüler kommen mit den Anforderungen der aufnehmenden Einrichtungen gut zurecht und absolvieren den weiterführenden Bildungsweg erfolgreich.
- Die Schule trägt dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler motiviert und befähigt sind, lebenslang zu lernen.
- Die Schule trägt dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler kreativ mit neuen Anforderungen umgehen und sich entsprechende Kompetenzen und Wissensbestände selbstständig in unterschiedlichen Kontexten, auch unter Nutzung digitaler Möglichkeiten und Angebote, erarbeiten können.
Erläuterungen
Unter anderem wird von der Schule erwartet, die Anschlussfähigkeit der Schülerinnen und Schüler an weiterführende Schulen, Ausbildung, Studium und Beruf sicher zu stellen. Auch wenn vielfältige Einflüsse eine Rolle spielen, sind die fachlichen, personalen und sozialen Kompetenzen, zu deren Entwicklung die Schule beiträgt, weit über die Schulzeit hinaus grundlegend für die Fähigkeiten und Bereitschaften, weiter zu lernen und sich auf neue Anforderungen flexibel einstellen zu können. Die nachhaltigen Wirkungen der schulisch begleiteten Lern- und Entwicklungsprozesse lassen sich vor allem am weiteren Bildungs- bzw. Ausbildungsweg der Schülerinnen und Schüler erkennen.
Ergänzend können auch die in Bezug zum „Übergangsmanagement“ im Kriterium 2.8.4 eingestellten Materialien für die Gestaltung der Prozesse hilfreich sein. Probleme oder Hinweise zu diesem Material meldenMaterialien
Das Institut für Demoskopie Allensbach hat im Auftrag der Vodafone Stiftung in ganz Deutschland Schülerinnen und Schüler befragt, wie sie sich auf ihre Ausbildungs- und Berufswahl vorbereiten, welche Unterstützung sie bekommen und hilfreich finden und welche weiteren Hilfen sie benötigen. Gleichzeitig wurden für diese Studie Erziehungsberechtigte dazu befragt, wie sie ihre Kinder in dieser wichtigen Phase unterstützen.
Es wird deutlich, dass eine professionelle und individuelle Berufsorientierung, die an den Schulen die Erfahrungen von Unternehmen und den zuständigen Behörden, wie der Bundesagentur für Arbeit, zusammenbringt, wünschenswert wären.
In der Schulzeitdebatte wird angenommen, dass Absolventinnen und Absolventen, die das Abitur nach 12 Schuljahren erworben haben, häufiger als diejenigen mit 13-jähriger Schulzeit eine freiwillige Auszeit zwischen Schule und Studium einlegen. Die Studie geht dieser Frage anhand von auf Deutschland bezogene repräsentative Daten nach.
Link zum Material eingesehen am: 26.01.2024Probleme oder Hinweise zu diesem Material meldenDie Fachserie "Berufliche Bildung" erhebt jährlich Daten über Auszubildende, z. B. nach Ausbildungsbereichen und Ausbildungsberufen, über neu abgeschlossene und vorzeitig gelöste Ausbildungsverträge sowie über Teilnahmen an Abschlussprüfungen.
Der erste Link führt zur Übersichtsseite zum Themengebiet "Berufliche Bildung", der zweite Link bietet einzelne Ergebnisse zur Auswahl an.
1.4.3 Die Schule schafft Voraussetzungen dafür, dass die Schülerinnen und Schüler sich in ihrer weiteren Biographie am politischen und gesellschaftlichen Leben beteiligen können und Lebens- und Berufsperspektiven für sich selbst erkennen und nutzen.
Aufschließende Aussagen
- Die Schule trägt zur Entwicklung von Wertorientierungen und Haltungen bei, die für die Bereitschaft, sich auf der Grundlage der Grundrechte zu engagieren und am gesellschaftlichen Leben aktiv teilzuhaben, grundlegend sind.
- Die Schule trägt dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler sich in politischen und gesellschaftlichen Bereichen engagieren und Verantwortung übernehmen.
- Die Schule trägt dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler aktiv am kulturellen Leben teilnehmen können.
- Die Schule trägt dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler die Bereitschaft entwickeln, sich ehrenamtlich zu engagieren.
Erläuterungen
Der schulische Lebens- und Lernraum ist Teil der vielfältigen auch außerschulisch geprägten Sozialisations-, Bildungs- und Erziehungsprozesse, die letztlich eine Persönlichkeit, ihre Haltungen und die weiteren sozialen Entwicklungschancen prägen. Ein zentrales Bildungs- und Erziehungsziel aller Schulgesetze der Bundesländer ist der mündige, urteilsfähige Mensch, der sich gesellschaftlich einbringen und beteiligen kann. Die Schule nimmt die Verantwortung, die Schülerinnen und Schüler auf die Beteiligung am gesellschaftlichen Leben vorzubereiten, u. a. dadurch wahr, dass sie neben anderen Institutionen (Vereine, Kulturstätten etc.) Gelegenheiten zur Übernahme von Verantwortung in der Schule sowie Möglichkeiten zur Teilhabe am kulturellen, sozialen und kommunalen Leben für die Schülerinnen und Schüler schafft und systematisch bei pädagogisch-didaktischen Entscheidungen auch langfristige Wirkungen für Schülerinnen und Schüler mit reflektiert.
Absolventenbefragungen können darüber Aufschluss geben, wie gut es der Schule gelungen ist, ihre Schülerinnen und Schüler zu befähigen, sich in ihrer weiteren Biographie am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen.
Hier sei auf die unterschiedlichen Aktivitäten verwiesen, die sich aus den Materialien der Inhaltsbereiche 2 zu „Lehren und Lernen“ und vor allem 3 zur „Schulkultur“ heranziehen lassen, welche Schulen darin unterstützen sollen, ihre Schülerinnen und Schüler zur gesellschaftlichen Teilhabe zu befähigen. Probleme oder Hinweise zu diesem Material meldenMaterialien
Das OECD-Projekt Education 2030 stellt einen Rahmen für das Lernen bereit, so dass Kinder und Jugendliche dabei unterstützt werden können, ihre Gestaltungs- und Handlungskompetenz eigenständig zu entwickeln. Der OECD Lernkompass 2030 stellt die Kompetenzen dar, die die Schülerinnen und Schüler brauchen, um sich für ihr individuelles und das gesellschaftliche Wohlergehen einzusetzen. Diese Skills entwickeln sie durch das gestaltende, unterstützende Zusammenwirken, der „Co-Agency“ ihres Umfelds, zu denen ihre Eltern, Gleichaltrige, ihren Lehrkräften sowie die erweiterte Gemeinschaft gehören.
Link zum Material eingesehen am: 26.01.2024Probleme oder Hinweise zu diesem Material meldenBei dieser Publikation handelt es sich im Vorträge und Debatten, die bei der Konferenz "Die Zukunft beginnt um kurz vor acht" vorgetragen und diskutiert worden sind. In dieser Webveröffentlichung wird über die Bildungsstandards des 21. Jahrhundert diskutiert. Folgenden Fragen werden diskutiert: Sind die jetzigen Bildungsstandards noch zeitgemäß? Was könnte verändert werden, bezogen auf die einzelnen Schulformen?
Link zur Webveröffentlichung eingesehen am: 26.01.2024Probleme oder Hinweise zu diesem Material meldenDie dargestellten Ergebnisse dieser Abschlussdokumentation, eine Fortsetzung des Programms „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKi) der Länder NRW und Hamburg, beantworten die Frage: Welche Auswirkungen hat Musikunterricht, wenn er mit dem Erlernen eines Instruments verbunden ist, auf den kulturellen und besonders den musikalischen Bildungsverlauf von Kindern? Mit dem zweiten Link gelangen Sie direkt zur Ausgangsstudie "Instrumentalunterricht in der Grundschule - Prozess- und Wirkungsanalysen zum Programm: Jedem Kind ein Instrument".
Link zum Material 1 eingesehen am: 26.01.2024Link zum Material 2 eingesehen am: 26.01.2024Probleme oder Hinweise zu diesem Material meldenIn dieser OECD-Studie werden 16 bis 65 Jahre alte Erwachsene in Lesen, alltagsmathematischen Kompetenzen und technologiebasiertem Problemlösen getestet. PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) wurde im Jahr 2012 zum ersten Mal in 24 Ländern durchgeführt und soll alle zehn Jahre wiederholt werden. Hierzu wurden in jedem Land mindestens 5.000 Erwachsene befragt und getestet.
Link zum Material eingesehen am: 26.01.2024Probleme oder Hinweise zu diesem Material meldenAngefragt!
Veranstaltungsformate zur Implementation des Referenzrahmens Schulqualität NRW (RRSQ)
Unter anderem für folgende Zielgruppen bietet das QUA-LiS-Team RRSQ speziell entwickelte Veranstaltungsformate an: • Schulleitungen u. Steuergruppen • Schulaufsicht • Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) • Fachleitungen in den ZfsL • Seminare der ZfsL • Ausbildungsbeauftragte der ZfsL-Kooperationsschulen • Kompetenzteams • Orientierungsseminare • Qualifizierungsseminare „Neu im Amt“ Die folgende Tabelle skizziert den möglichen Ablauf einer […]
weiterlesenExterne Kooperationen – Chancen für die Schulentwicklung: Referenzrahmen Schulqualität NRW und das Online-Unterstützungsportal
Die Schulen in NRW nutzen Kooperationen mit Institutionen, Initiativen und Vereinen und weiteren Partnern zur Gestaltung ihrer schulischen Arbeit. Den Schülerinnen und Schülern ermöglichen sie weitergehende Erfahrungs- und Lernangebote, wozu u.a. Schüleraustauschprogramme, Netzwerkarbeiten, Betriebserkundigungen und kulturelle Angebote gehören. Insgesamt 21 (von 37) Dimensionen des Referenzrahmens Schulqualität NRW – insbesondere aus den Inhaltsbereichen Schulkultur, Professionalisierung, Führung […]
weiterlesenSchulprogramm und Schulprogrammarbeit – Chancen für die Schulentwicklung: Referenzrahmen Schulqualität NRW und das Online-Unterstützungsportal
Die Schulen in NRW legen auf der Grundlage ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags die besonderen Ziele, Schwerpunkte und Organisationsformen ihrer pädagogischen Arbeit in einem Schulprogramm fest und schreiben es regelmäßig fort. (SchulG § 3, Abs. 2, Satz 1). Das querstrukturelle Thema Schulprogramm wird im Kriterium 2.1.4 aufgegriffen. Schulprogrammarbeit berührt nicht nur den Inhaltsbereich 5 Führung und […]
weiterlesen
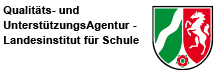
 Kontakt
Kontakt