Beispiel eines schulinternen Lehrplans für die Hauptschule im Fach Mathematik
Hinweis: Als Beispiel eines schulinternen Lehrplans auf der Grundlage des Kernlehrplans Arbeitslehre für die Hauptschule steht hier der schulinterne Lehrplan der fiktiven Lise-Meitner-Hauptschule zur Verfügung.
1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit
Hinweis: Um zu verdeutlichen, wie die jeweils spezifischen Rahmenbedingungen einer Schule den schulinternen Lehrplan beeinflussen können, wird in Kapitel 1 zunächst die Schule näher vorgestellt. Den Fachkonferenzen wird empfohlen, für ihre Schule eine strukturierte Beschreibung zu erstellen, die sich an den Aspekten im vorliegenden Beispiel orientiert, um die Ausgangsbedingungen für den schulinternen Lehrplan festzuhalten (ggf. nur in Stichworten und nicht ausformuliert).
- Lage der Schule
- Größe und Ausstattung
- Unterrichtstaktung
- Stundenverortung und Lehrkräfte
- Schulprogramm
- Fachziele
Die fiktive Lise-Meitner-Hauptschule liegt am Stadtrand von Dortmund mit gemischtem städtischem und teilweise ländlichen Einzgsbereich. Der Migrationsanteil der Schüler liegt bei ca. 40%. Die Klassenstärke liegt bei ca. 25 Schülerinnen und Schülern.
In den Unterrichtsvorhaben wurden ab der Klasse 8 Berufsorientierungsmaßnahmen incl. Vor- und Nachbereitung sowie Betriebsbesichtigungen berücksichtigt, um die Relevanz von Mathematik für das Berufsleben zu verdeutlichen. Besonders wertvoll sind dabei die Praktikumserfahrungen, die Schülerinnen und Schüler der Lise-Meitner-Hauptschule mit Partnerfirmen aus der metallverarbeitenden Industrie gewinnen.
2 Entscheidungen zum Unterricht
2.1 Unterrichtsvorhaben
Grundlage der Fachkonferenzarbeit der Lise-Meitner-Hauptschule ist das "Raster als Gerüst für die Entwicklung eines schulinternen Lehrplans im Fach Mathematik". Der vorliegende Plan ist für alle Kolleginnen und Kolegen insgesamt verbindlich umzusetzen. Allerdings kann die zeitliche Abfolge auch individuell auf die Klassensituation bezogen verändert werden. Der Plan soll vor allen Dingen neuen Kolleginnen und Kollegen sowie Referendarinnen und Referendaren ein Leitfaden für ihre Unterrichtsplanung darstellen. Es ist geplant, später auch Eltern die Unterrichtsplanung in Form einer Jahrgangspartitur auf der Homepage der Schule zur Verfügung zu stellen. Dort werden dann selbstverständlich auch die anderen an der Lise-Meitner-Hauptschule unterrichteten Fächer vorgestellt.
Orientiert an den Inhalten des Rasters wurden kontextbezogene Unterrichtsvorhaben entwickelt. Die Reihenfolge bezieht sich auf das Raster und stellt keine verbindliche zeitliche Abfolge dar. Die Unterrichtsreihen 9_3 und 9_4 werden an der Lise-Meitner-Hauptschule Beispielschule gemeinsam durchgeführt.
Jahrgang 5
|
Unterrichtsschwerpunkt mit Ausweisung der
verbindlichen fachlichen Gegenstände
|
Vereinbarung zur besonderen
Berücksichtigung mathematischer Prozesse
|
Hinweise zu fachlichen Gegenständen und Vereinbarungen zur Didaktik und Methodik
|
Vereinbarungen zu verbindlichen Kontexten
(LP = Lebensplanung, BO = Berufsorientierung)
|
|
Beschreibende Statistik
- Datenerhebungen durchführen
- Daten in Ur- und Strichlisten sowie Häufigkeitstabellen auswerten
- Daten in Säulendiagrammen präsentieren
- statistische Darstellungen interpretieren
|
- Modellieren
- Kommunizieren: Darstellungsformen
- Werkzeuge: Tabellenkalkulation
- Werkzeuge: Beginn der Arbeit an und mit einem Regelheft (Merkheft)
|
- Fragebogen mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam erstellen
- Prozess der Informationsgewinnung durch Datenreduktion bewusst machen
- gegebene Diagramme interpretieren
|
- Freizeitverhalten / Fernsehkonsum (LP)
- Berufliche Tätigkeiten im familiären Kontext (BO)
|
|
Zahlen und ihre Darstellung
- ganze Zahlen in unterschiedlichen Formen darstellen (Zahlengerade, Zifferndarstellung, 10er-Stellenwerttafel, Wortform)
- Dezimalzahlen ordnen, vergleichen und runden
- Bruchteile in unterschiedlichen Formen darstellen (geometrisch, als Dezimal- und Prozentzahl)
|
- Modellieren
- Problemlösen
- Kommunizieren: Darstellungsformen
- Kommunizieren: Verbalisieren
|
- negative Zahlen im Anwendungszusammenhang (Temperatur, Geld) und am Zahlenstrahl
- hier: Ordnen, Vergleichen und Runden von natürlichen Zahlen
- hier: Anteilsvorstellung von Bruchteilen, d. h. geometrische Darstellung (propädeutisch)
|
- Stadtplan / Landkarte / Fahrplan (LP)
|
|
Rechnen mit natürlichen Zahlen
- Grundrechenarten mit Dezimalzahlen durchführen (Division nur durch natürliche Zahlen)
- schätzen und überschlagen
- systematisch zählen
- Gesetzmäßigkeiten in Beziehungen zwischen Zahlen nutzen
- Teiler und Vielfache natürlicher Zahlen bestimmen sowie Teilbarkeitsregeln (2, 3, 5, 10) nutzen
|
- Problemlösen
- Argumentieren
- Kommunizieren: Verbalisieren
|
- hier: Grundrechenarten mit natürlichen Zahlen
- wichtig: Kopfrechnen und vorteilhaftes Rechnen
- schriftliche und halbschriftliche Rechenverfahren schließen an die Grundschule an
- Darstellungsformen aus der Grundschule fortführen (u. a. "Malkreuz")
- Aufgabenformate aus der Grundschule fortführen (u. a. "Zahlenmauern")
|
|
|
Grundfiguren in Ebene und Raum
- mit den Grundbegriffen der ebenen und räumlichen Geometrie arbeiten (Punkt, Gerade, Strahl/Halbgerade, Strecke, Winkel, Abstand, Radius, parallel, senkrecht, achsensymmetrisch, punktsymmetrisch)
- Grundfiguren und Grundkörper begrifflich unterscheiden (Rechteck, Quadrat, Parallelogramm, Dreieck, Kreis, Quader, Würfel, Kugel, Pyramide, Zylinder, Kegel)
- im ebenen Koordinatensystem arbeiten
- Winkel von ebenen Figuren messen, zeichnen und schätzen
|
- Modellieren
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Verbalisieren
- Werkzeuge: Geodreieck und Zirkel
|
- Bezüge zur Umwelt herstellen
- Abstraktionsprozess von konkreten Objekten zu idealisierten Begriffen reflektieren
- Figuren und Muster aus der Umwelt mit den erworbenen Begriffen strukturieren und reproduzieren
- Untersuchungen zur Achsensymmetrie mithilfe von Taschenspiegeln
- Darstellung und Untersuchung ebener Figuren im KOS
|
|
|
Rechnen mit Größen
- Größen umwandeln und mit ihnen rechnen (Geld, Längen, Gewicht, Zeit)
- Beziehungen zwischen Zahlen bzw. Größen in Verbalisierungen, Tabellen und Diagrammen darstellen
- Dezimalzahlen ordnen, vergleichen und runden
- Grundrechenarten mit Dezimalzahlen durchführen (Division nur durch natürliche Zahlen)
|
- Modellieren
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Darstellungsformen
- Kommunizieren: Verbalisieren
|
- hier: Umwandeln von und Rechnen mit Zeit, Gewicht und Geld (auch in Fremdwährungen)
- wichtig: im Sachkontext angemessene Wahl der konkreten Maßeinheit
- wichtig: Umgang mit (Mess- und Rundungs-) Genauigkeit
- Tabellen als Darstellungsform verwenden
|
- Einkaufen / Taschengeld (LP)
- Stadtplan / Landkarte / Fahrplan (LP)
|
|
Umfang und Flächeninhalte
- Umfänge von Vielecken bestimmen
- Flächeninhalte von Rechtecken bestimmen
|
|
- Flächeninhalte auslegen
- Flächeninhalt vom Umfang abgrenzen
|
|
Jahrgangsstufe 6
|
Unterrichtsschwerpunkt mit Ausweisung der
verbindlichen fachlichen Gegenstände
|
Vereinbarung zur besonderen
Berücksichtigung mathematischer Prozesse
|
Hinweise zu fachlichen Gegenständen und Vereinbarungen zur Didaktik und Methodik
|
Vereinbarungen zu verbindlichen Kontexten
(LP = Lebensplanung, BO = Berufsorientierung)
|
|
Brüche
- Bruchteile in unterschiedlichen Formen darstellen (geometrisch, als Dezimal- und Prozentzahl) (Wdh.)
- gleichnamige Brüche addieren und subtrahieren
|
- Argumentieren
- Kommunizieren: Darstellungsformen
- Kommunizieren: Verbalisieren
|
- hier: Anteilsvorstellung von Bruchteilen, d. h. geometrische Darstellung
- auch: Bruchteile vergleichen
|
|
|
Dezimalbrüche
- Bruchteile in unterschiedlichen Formen darstellen (geometrisch, als Dezimal- und Prozentzahl)
- endliche Dezimalzahlen in Brüche umwandeln (und umgekehrt)
|
- Problemlösen
- Kommunizieren: Darstellungsformen
- Kommunizieren: Verbalisieren
|
- hier: Darstellung von Bruchteilen als Dezimal- und Prozentzahl
- Darstellung als Prozentzahl mit geeigneten Visualisierungen
|
|
|
Zufall und Beschreibende Statistik
- relative Häufigkeiten, arithmetisches Mittel und Median bestimmen
- Zufallsexperimente durchführen und auswerten
- Daten in Ur- und Strichlisten sowie Häufigkeitstabellen auswerten (Wdh.)
- Daten in Säulendiagrammen präsentieren (Wdh.)
|
- Modellieren
- Kommunizieren: Darstellungsformen
- Kommunizieren: Verbalisieren
- Werkzeuge: Tabellenkalkulation
|
- relative Häufigkeiten, arithmetisches Mittel und Median für Datenreihen aus dem Alltag entwickeln
- klassische Zufallsgeräte wie Würfel nutzen
- erste Annäherung ans empirische Gesetz der großen Zahl
- relative Häufigkeiten auch theoretisch erklären
|
|
|
Oberflächen und Volumina von Körpern
- Würfel- und Quadernetze anfertigen
- Oberflächen und Volumina von Würfeln und Quadern bestimmen
|
- Problemlösen
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Werkzeuge: Geodreieck
|
- "Wie viele verschiedene Würfelnetze gibt es?"
- Formeln für Oberflächen und Volumen entwickeln lassen
|
|
|
Bruchzahlen
- Teiler und Vielfache natürlicher Zahlen bestimmen
sowie Teilbarkeitsregeln (2, 3, 5, 10) nutzen (Wdh.)
- Brüche kürzen und erweitern
- Bruchteile in unterschiedlichen Formen darstellen (geometrisch, als Dezimal- und Prozentzahl) (Wdh.)
|
- Problemlösen
- Argumentieren
- Kommunizieren: Darstellungsformen
- Kommunizieren: Verbalisieren
|
- Teilbarkeitsregeln entdecken und begründen lassen
- wichtig: Vielfalt der Darstellungsmittel (Kreis, Rechteck, "Exis"…)
- Kürzen und Erweitern als Vergröbern und Verfeinern
|
|
|
Maßstab
- Maßstabsverhältnisse bestimmen
- Würfel- und Quadernetze anfertigen (Wdh.)
- im ebenen Koordinatensystem arbeiten (Wdh.)
- Größen umwandeln und mit ihnen rechnen (Geld, Längen, Gewicht, Zeit)
|
- Modellieren
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Darstellungsformen
- Werkzeuge: Geodreieck
|
- hier: Umwandeln von und Rechnen mit Längen
- Stadtpläne und Landkarten nach Absprache mit FS Erkunde
- ggf. Satellitenaufnahme, Straßenkarten und Hybriddarstellungen aus dem Internet
- ggf. Exkursion: geographische Gegebenheiten selbst "kartieren"
- Modelle anfertigen (Würfel und Quader)
|
- Stadtplan / Landkarte / Fahrplan (LP)
|
Jahrgangsstufe 7 (Grund- und Erweiterungskurs)
|
Unterrichtsschwerpunkt mit Ausweisung der
verbindlichen fachlichen Gegenstände
|
Vereinbarung zur besonderen
Berücksichtigung mathematischer Prozesse
|
Hinweise zu fachlichen Gegenständen und Vereinbarungen zur Didaktik und Methodik
|
Vereinbarungen zu verbindlichen Kontexten
(LP = Lebensplanung, BO = Berufsorientierung)
|
|
Rechnen mit positiven rationalen Zahlen
- Grundrechenarten mit rationalen Zahlen durchführen (Division nur durch natürliche Zahlen)
- rationale Zahlen ordnen und vergleichen
|
- Argumentieren
- Kommunizieren: Verbalisieren
- Werkzeuge: Einführung des Taschenrechners am Ende der Unterrichtsreihe
|
- hier: Grundrechenarten mit positiven rationalen Zahlen
- hier: Ordnen und Vergleichen von positiven rationalen Zahlen
- alle Grundrechenarten mit Brüchen
|
|
|
Konstruktion von Dreiecken
- Dreiecke aus gegebenen Winkel- und Seitenmaßen konstruieren
- Winkelsätze nutzen (Neben-, Stufen- und Wechselwinkel; Winkelsumme in Dreiecken und Vierecken)
- Kongruenzen (im Sinne anschaulich evidenter Deckungsgleichheit) nutzen
zusätzlich E-Kurs:
|
- Problemlösen
- Argumentieren
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Verbalisieren
- Werkzeuge: Geodreieck und Zirkel
|
- "Wann lassen sich Dreiecke ganz einfach konstruieren?"
- "Wann entsteht kein eindeutiges Dreieck?"
- Deckungsgleichheit für alle propädeutisch thematisieren; Vertiefung im E-Kurs
- Winkelsumme für Dreiecke, Vierecke und Vielecke materialbasiert entdecken
|
|
|
Zuordnungen
- proportionale, antiproportionale und lineare Zuordnungen begrifflich unterscheiden und für Berechnungen nutzen
- Zuordnungen in Verbalisierungen, Wertetabellen, Graphen und Termen darstellen
- den Dreisatz nutzen
|
- Modellieren
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Darstellungsformen
- Kommunizieren: Verbalisieren
- Werkzeuge: Tabellenkalkulation
|
- hier: Darstellung von Zuordnungen in Verbalisierungen, Wertetabellen und Graphen
- parallele Behandlung verschiedener Zuordnungstypen; separate Systematisierung
- Darstellung in Tabellen und Graphen
- Dreisatz als ein Lösungsschema entwickeln
|
- Mathematik in verschiedenen Ausbildungsberufen (soziale / pflegerische Berufe) (BO)
|
|
Prozentrechnung
- Prozent- und Zinsrechnung durchführen
- den Dreisatz nutzen (Wdh.)
|
- Modellieren
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Verbalisieren
|
- hier: Prozentrechnung
- zunächst Umgang mit Prozentsätzen zwischen
0 % und 100 %
- funktionale Zusammenhänge zwischen den Größen in den Mittelpunkt stellen
|
- Mathematik in verschiedenen Ausbildungsberufen (Handel / Dienstleistungen) (BO)
- Ernährung (LP)
|
|
Zufall und Wahrscheinlichkeit
- Wahrscheinlichkeiten auf der Basis von Zufallsexperimenten schätzen (empirisches Gesetz der großen Zahl)
- unterschiedliche Wahrscheinlichkeitsansätze (Annahme der Gleichwahrscheinlichkeit, Prognose mithilfe relativer Häufigkeiten, subjektiver Grad der Überzeugung) begrifflich unterscheiden
|
- Modellieren
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Verbalisieren
|
- Wahrscheinlichkeit beim Werfen von Reißzwecken (empirisches Gesetz der großen Zahl)
- Laplace-Wahrscheinlichkeiten mit Würfel
- gemischte Überlegungen (relative Häufigkeit und Laplace) für Quader
- Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Ansätze herausarbeiten
|
|
|
Flächeninhalte ebener Figuren
- Flächen und Körper begrifflich unterscheiden (rechtwinklige, gleichschenklige und gleichseitige Dreiecke, Rauten, Drachenvierecke, Trapeze, Prismen/Säulen)
- Flächeninhalte von Dreiecken, Parallelogrammen und Trapezen und von daraus zusammengesetzten Flächen bestimmen
- Größen umwandeln und mit ihnen rechnen (Flächen, Volumina)
|
- Modellieren
- Problemlösen
- Argumentieren
- Kommunizieren: Verbalisieren
- Werkzeuge: Beginn der Arbeit mit einer Formelsammlung
|
- hier: ebene Figuren (rechtwinklige, gleichschenklige und gleichseitige Dreiecke, Rauten, Drachenvierecke, Trapeze) begrifflich unterscheiden
- hier: Umwandeln von und Rechnen mit Flächeninhalten
|
- Mathematik in verschiedenen Ausbildungsberufen (Handwerk) (BO)
- Grundrisse / Wohnflächen (LP)
|
Jahrgangsstufe 8 (Grund- und Erweiterungskurs)
|
Unterrichtsschwerpunkt mit Ausweisung der
verbindlichen fachlichen Gegenstände
|
Vereinbarung zur besonderen
Berücksichtigung mathematischer Prozesse
|
Hinweise zu fachlichen Gegenständen und Vereinbarungen zur Didaktik und Methodik
|
Vereinbarungen zu verbindlichen Kontexten
(LP = Lebensplanung, BO = Berufsorientierung)
|
|
Rechnen mit rationalen Zahlen
- Grundrechenarten mit rationalen Zahlen durchführen (Division nur durch natürliche Zahlen)
- Operationseigenschaften (Umkehrbarkeit, gleich- und gegensinniges Verändern) und Rechengesetze (Distributiv-, Kommutativ- und Assoziativgesetz) nutzen
- rationale Zahlen ordnen und vergleichen
- Grundrechenarten mit rationalen Zahlen durchführen (ohne Einschränkung)
zusätzlich E-Kurs:
|
- Modellieren
- Argumentieren
- Kommunizieren: Verbalisieren
|
- alle Grundrechenarten mit rationalen Zahlen, vor allem mit negativen rationalen Zahlen; Vertiefung im E-Kurs
- fortgesetztes Kopfrechnen mit geeigneten Aufgaben
- schriftliche und halbschriftliche Rechenverfahren
- Operationseigenschaften in strukturierten Übungspäckchen entdecken
- Darstellungswechsel beim Ordnen
|
- Lebenshaltungskosten (LP)
|
|
Datenerhebungen in Stichproben
- Datenerhebungen ausgehend von einer Fragestellung planen, durchführen und auswerten
- Daten in Kreisdiagrammen präsentieren
|
- Modellieren
- Kommunizieren: Darstellungsformen
- Werkzeuge: Tabellenkalkulation
|
- Ausgangspunkt: Wahlprognose oder Meinungsumfrage
- Fragebogen mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam erstellen
- Stichprobenproblematik und -größe durch Simulation untersuchen bzw. klären
|
|
|
Darstellungen, Oberflächen und Volumina von Körpern
- Flächen und Körper begrifflich unterscheiden (rechtwinklige, gleichschenklige und gleichseitige Dreiecke, Rauten, Drachenvierecke, Trapeze, Prismen/Säulen)
- Schrägbildskizzen von Würfeln und Quadern anfertigen
- Netze von Prismen/Säulen anfertigen
- Oberflächen und Volumina von Prismen/Säulen bestimmen
- Größen umwandeln und mit ihnen rechnen (Flächen, Volumina)
|
- Modellieren
- Problemlösen
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Darstellungsformen
- Kommunizieren: Verbalisieren
|
- hier: Körper (Prismen/Säulen) begrifflich unterscheiden
- Wiederholung der Oberflächen- und Volumenbestimmung aus Jahrgangsstufe 6
- Werkstücke berechnen
- Prismen aus selbst angefertigten Netzen bauen
- Stützpunktvorstellungen zu Volumina entwickeln
- Umrechnung Liter à Kubikzentimeter u. Ä. durch Stützpunktvorstellungen unterstützen
|
|
|
Prozent- und Zinsrechnung
- Prozent- und Zinsrechnung durchführen
|
- Modellieren
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Verbalisieren
|
- Visualisierungen und Rechenverfahren aus den Jahrgangsstufen 6 und 7 wiederholen
- Zinsrechnung mittels Wachstumsfaktor
|
- Mehrwertsteuer (LP)
- Ratenzahlung/Rabatte (LP)
|
|
Variablen, Terme und Gleichungen
- mit Variablen, Termen und Gleichungen arbeiten
- lineare Gleichungen lösen
|
- Modellieren
- Argumentieren
- Kommunizieren: Darstellungsformen
- Kommunizieren: Verbalisieren
|
- Sachverhalte algebraisch beschreiben
- zu Rechengeschichten und Sachsituationen Gleichungen erfinden
- "Knack die Box"
|
|
|
Darstellungsarten von Zuordnungen
- Zuordnungen in Verbalisierungen, Wertetabellen, Graphen und Termen darstellen
|
- Modellieren
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Darstellungsformen
- Kommunizieren: Verbalisieren
|
- Möglichkeiten und Grenzen einzelner Darstellungsarten diskutieren
- Geschichten zu Graphen erfinden
|
|
Jahrgangsstufe 9 (Grundkurs)
|
Unterrichtsschwerpunkt mit Ausweisung der
verbindlichen fachlichen Gegenstände
|
Vereinbarung zur besonderen
Berücksichtigung mathematischer Prozesse
|
Hinweise zu fachlichen Gegenständen und Vereinbarungen zur Didaktik und Methodik
|
Vereinbarungen zu verbindlichen Kontexten
(LP = Lebensplanung, BO = Berufsorientierung)
|
|
Satz des Pythagoras und Quadratwurzel
- den Satz des Pythagoras nutzen
- Quadratwurzeln und kubische Wurzeln bestimmen
|
- Problemlösen
- Argumentieren
|
- hier: Bestimmung von Quadratwurzeln
- Quadratwurzeln als Umkehrung des Quadrierens (auch näherungsweise) bestimmen
- handlungsorientierte Zerlegungs- und Ergänzungsbeweise
|
|
|
Potenzschreibweise
- rationale Zahlen in der Zehnerpotenz-Schreibweise darstellen
|
- Modellieren
- Kommunizieren: Darstellungsformen
|
- Stellenwertsystem wiederholen
- große und kleine Zahlen im Kontext von Größen; Umgang mit Genauigkeit
|
|
|
Lineare Funktionen
- mit linearen Funktionen arbeiten
|
|
- lineare Vorgänge modellieren
- Lösen von linearen Gleichungen wiederholen
- alle Darstellungswechsel berücksichtigen
- von (gemessenen) Daten zur Funktion
|
- Tarif- und Preisvergleiche (LP)
|
|
Darstellung von Funktionen
- Funktionen in Verbalisierungen, Wertetabellen, Graphen und Termen (bzw. Funktionsgleichungen) darstellen
|
- Modellieren
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Darstellungsformen
- Kommunizieren: Verbalisieren
|
- qualitatives Arbeiten mit Funktionen
- Zuordnung von Graph und Situation
- Geschichten erfinden
- von Daten über Tabellen zu Funktionsgraphen und ggf. -gleichungen
|
- Mathematik in verschiedenen Ausbildungsberufen (soziale/pflegerische Berufe) (BO)
|
|
Kreis- und Zylinderberechnung
- Schrägbildskizzen und Netze von Zylindern, Pyramiden und Kegeln anfertigen
- Umfänge und Flächeninhalte von Kreisen und Kreissektoren sowie Oberflächen und Volumina von Zylindern, Pyramiden, Kegeln und Kugeln und von daraus zusammengesetzten Körpern bestimmen
|
- Problemlösen
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Darstellungsformen
- Werkzeuge: Geodreieck und Zirkel
|
- hier: Schrägbildskizzen und Netze von Zylindern
- hier: Umfänge und Flächeninhalte von Kreisen und Kreissektoren sowie Oberfläche und Volumen von Zylindern
- Entdeckung und Bestimmung der Kreiszahl durch Messen von Umfang und Durchmesser
- Flächenbestimmung durch "Ausschöpfen"
|
|
|
Analyse statistischer Darstellungen
- statistische Darstellungen (insbesondere "Manipulationen") analysieren
|
- Modellieren
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Verbalisieren
- Kommunizieren: Recherchieren
- Werkzeuge: Tabellenkalkulation
|
- Informieren mithilfe von statistischen Darstellungen (vor allem: Diagramme)
- Erstellung alternativer Darstellungen bei "schlechten" Darstellungen
- Aufdecken von "Manipulationen" durch statistische Darstellungen
|
- "Manipulationen" (LP)
- Arbeitsmarktdaten (BO)
- Mathematik in verschiedenen Ausbildungsberufen (Verwaltung) (BO)
|
Jahrgangsstufe 9 (Erweiterungskurs)
|
Unterrichtsschwerpunkt mit Ausweisung der
verbindlichen fachlichen Gegenstände
|
Vereinbarung zur besonderen
Berücksichtigung mathematischer Prozesse
|
Hinweise zu fachlichen Gegenständen und Vereinbarungen zur Didaktik und Methodik
|
Vereinbarungen zu verbindlichen Kontexten
(LP = Lebensplanung, BO = Berufsorientierung)
|
|
Satz des Pythagoras und Quadratwurzel, Satz des Thales
- den Satz des Pythagoras nutzen
- Quadratwurzeln und kubische Wurzeln bestimmen
- Den Satz des Thales nutzen
|
- Problemlösen
- Argumentieren
- Werkzeuge: Dynamische-Geometrie-Software
|
- hier: Bestimmung von Quadratwurzeln
- Quadratwurzeln als Umkehrung des Quadrierens (auch näherungsweise) bestimmen
- handlungsorientierte Zerlegungs- und Ergänzungsbeweise
- Satz des Thales mit DGS entdecken
|
|
|
Potenzschreibweise, Potenzieren und Radizieren
- rationale Zahlen in der Zehnerpotenz-Schreibweise darstellen
- Potenzen mit ganzzahligen Exponenten berechnen und als Umkehrung radizieren
- Terme ausmultiplizieren, faktorisieren und binomische Formeln nutzen
|
- Modellieren
- Problemlösen
- Kommunizieren: Darstellungsformen
- Kommunizieren: Verbalisieren
|
- hier: Ausmultiplizieren und Faktorisieren von Termen
- Stellenwertsystem wiederholen
- große und kleine Zahlen im Kontext von Größen; Umgang mit Genauigkeit
- näherungsweises Radizieren durch Umkehren
|
|
|
Lineare Funktionen und Gleichungssysteme
- mit linearen Funktionen arbeiten
- lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen lösen
|
- Modellieren
- Argumentieren
- Kommunizieren: Darstellungsformen
|
- lineare Vorgänge modellieren
- Lösen von linearen Gleichungen wiederholen
- alle Darstellungswechsel berücksichtigen
- von (gemessenen) Daten zur Funktion
- Darstellungswechsel bei Gleichungssystemen
|
- Tarif- und Preisvergleiche (LP)
|
|
Darstellung von Funktionen
- Funktionen in Verbalisierungen, Wertetabellen, Graphen und Termen (bzw. Funktionsgleichungen) darstellen
|
- Modellieren
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Darstellungsformen
- Kommunizieren: Verbalisieren
|
- qualitatives Arbeiten mit Funktionen
- Zuordnung von Graph und Situation
- Geschichten erfinden
- von Daten über Tabellen zu Funktionsgraphen und ggf. -gleichungen
|
- Mathematik in verschiedenen Ausbildungsberufen (soziale/pflegerische Berufe) (BO)
|
|
Kreis- und Zylinderberechnung
- Schrägbildskizzen und Netze von Zylindern, Pyramiden und Kegeln anfertigen
- Umfänge und Flächeninhalte von Kreisen und Kreissektoren sowie Oberflächen und Volumina von Zylindern, Pyramiden, Kegeln und Kugeln und von daraus zusammengesetzten Körpern bestimmen
|
- Modellieren
- Problemlösen
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Darstellungsformen
- Werkzeuge: Geodreieck und Zirkel
|
- hier: Schrägbildskizzen und Netze von Zylindern
- hier: Umfänge und Flächeninhalte von Kreisen und Kreissektoren sowie Oberflächen und Volumina von Zylindern
- Entdeckung und Bestimmung der Kreiszahl durch Messen von Umfang und Durchmesser
- Flächenbestimmung durch "Ausschöpfen"
|
|
|
Boxplots und Analyse statistischer Darstellungen
- Daten in Boxplots präsentieren
- statistische Darstellungen (insbesondere "Manipulationen") analysieren
|
- Modellieren
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Darstellungsformen
- Kommunizieren: Verbalisieren
- Kommunizieren: Recherchieren
- Werkzeuge: Tabellenkalkulation
|
- Boxplots für geeignete Datenreihen entwickeln (Vergleich mehrerer großer Gruppen)
- Informieren mithilfe von statistischen Darstellungen (vor allem: Diagramme)
- Erstellung alternativer Darstellungen bei "schlechten" Darstellungen
- Erarbeitung einer Checkliste für das Aufdecken "manipulierter" Darstellungen
|
- "Manipulationen" (LP)
- Arbeitsmarktdaten (BO)
- Mathematik in verschiedenen Ausbildungsberufen (Verwaltung) (BO)
|
Jahrgangsstufe 10 (Typ A)
|
Unterrichtsschwerpunkt mit Ausweisung der
verbindlichen fachlichen Gegenstände
|
Vereinbarung zur besonderen
Berücksichtigung mathematischer Prozesse
|
Hinweise zu fachlichen Gegenständen und Vereinbarungen zur Didaktik und Methodik
|
Vereinbarungen zu verbindlichen Kontexten
(LP = Lebensplanung, BO = Berufsorientierung)
|
|
Wiederholung: Figuren in Ebene und Raum
|
- Modellieren
- Argumentieren
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Verbalisieren
|
- Gegebenheiten der Umwelt mit geometrischen Figuren strukturieren und reproduzieren
- Herleitung von Flächenformeln durch Zerlegen und Ergänzen wiederholen
- Berechnungen von Längen, Flächen, Volumina und Winkeln in Alltagszusammenhängen
- Aufbau von Stützpunktvorstellungen
|
|
|
Darstellungen, Oberflächen und Volumina von Körpern
- Quadratwurzeln und kubische Wurzeln bestimmen
- Umfänge und Flächeninhalte von Kreisen und Kreissektoren sowie Oberflächen und Volumina von Zylindern, Pyramiden, Kegeln und Kugeln und von daraus zusammengesetzten Körpern bestimmen
|
- Modellieren
- Problemlösen
- Kommunizieren: Darstellungsformen
|
- Werkstücke berechnen
- kubische Wurzeln bei der Umkehrung von Volumenberechnungen verwenden und auch näherungsweise bestimmen
- fortgesetzter Aufbau von Stützpunktvorstellungen (auch zum Schätzen und Überschlagen)
|
- Mathematik in verschiedenen Ausbildungsberufen (Handwerk, Industrie) (BO)
|
|
Wiederholung: Rechnen mit rationalen Zahlen
|
- Modellieren
- Argumentieren
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Verbalisieren
|
- Rechnen in Alltagszusammenhängen
- Kopfrechnen
- vorteilhaftes Rechnen
- Operationseigenschaften nutzen
- Schätzen, Überschlagen und Runden
|
|
|
Wiederholung: Zuordnungen/Funktionen
|
- Modellieren
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Darstellungsformen
- Kommunizieren: Verbalisieren
|
- Zuordnungen in Alltagszusammenhängen (Sachrechnen)
- Darstellungswechsel
|
- Verkehr (LP)
- Ernährung (LP)
|
|
Zinseszins
- Zinseszinsrechnung durchführen
|
- Modellieren
- Problemlösen
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Recherchieren
- Werkzeuge: Tabellenkalkulation
|
- Wiederholung der Zinsrechnung mit Wachstumsfaktor aus Jahrgangsstufe 8
- besondere Sensibilisierung für die Überschuldungsproblematik
- Umkehrbetrachtungen exemplarisch durchführen
|
- Kredite/Überschuldung (LP)
- Altersvorsorge/Kaufkraft(-verlust) (LP)
- Mathematik in verschiedenen Ausbildungsberufen (Handel/Dienstleistungen) (BO)
|
|
Wiederholung: Rechnen mit Größen
|
- Modellieren
- Kommunizieren: Darstellungsformen
- Kommunizieren: Verbalisieren
|
- Umwandeln von Größen in Alltagszusammenhängen
- unterschiedliches Wachstumsverhalten von Längen, Flächen und Volumina untersuchen
|
|
Jahrgangsstufe 10 (Typ B)
|
Unterrichtsschwerpunkt mit Ausweisung der
verbindlichen fachlichen Gegenstände
|
Vereinbarung zur besonderen
Berücksichtigung mathematischer Prozesse
|
Hinweise zu fachlichen Gegenständen und Vereinbarungen zur Didaktik und Methodik
|
Vereinbarungen zu verbindlichen Kontexten
(LP = Lebensplanung, BO = Berufsorientierung)
|
|
Darstellungen, Oberflächen und Volumina von Körpern
- Quadratwurzeln und kubische Wurzeln bestimmen
- Umfänge und Flächeninhalte von Kreisen und Kreissektoren sowie Oberflächen und Volumina von Zylindern, Pyramiden, Kegeln und Kugeln und von daraus zusammengesetzten Körpern bestimmen
|
- Modellieren
- Problemlösen
- Kommunizieren: Darstellungsformen
|
- Werkstücke berechnen
- kubische Wurzeln bei der Umkehrung von Volumenberechnungen verwenden und auch näherungsweise bestimmen
- Aufbau von Stützpunktvorstellungen (auch zum Schätzen und Überschlagen)
|
- Mathematik in verschiedenen Ausbildungsberufen (Handwerk, Industrie) (BO)
|
|
Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Baumdiagramme und Pfadregeln nutzen
|
- Modellieren
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Darstellungsformen
- Kommunizieren: Recherchieren
|
- Wahrscheinlichkeitsrechnung in Alltagszusammenhängen
- Interpretation von Wahrscheinlichkeitsaussagen bei medizinischen Tests, der Sicherheit technischer Anlagen u. Ä.
- Berechnung von Wahrscheinlichkeiten bei klassischen Glücksspielen
|
|
|
Ähnlichkeit ebener Figuren
- Figuren maßstabsgetreu vergrößern und verkleinern
|
- Problemlösen
- Werkzeuge: Dynamische-Geometrie-Software
|
- Wiederholung der Maßstabsrechnung aus Jahrgangsstufe 6
- Erzeugung und Untersuchung ähnlicher Figuren mit DGS
- Änderungsverhalten von Längen, Flächen, Volumina und Winkeln bei ähnlicher Vergrößerung und Verkleinerung
|
|
|
Trigonometrie
- mithilfe der Definitionen von Sinus, Kosinus und Tangens Längen und Winkel bestimmen
- mit der Sinusfunktion periodische Vorgänge beschreiben
|
- Modellieren
- Argumentieren
- Werkzeuge: Dynamische-Geometrie-Software
|
- Motivation von Sinus, Kosinus und Tangens an ähnlichen rechtwinkligen Dreiecken (DGS)
- Sinussatz entdecken und beweisen
- Definition der Sinusfunktion am Einheitskreis (DGS)
- Trigonometrie in Alltagszusammenhängen
|
|
|
Quadratische Funktionen und Gleichungen
- Terme ausmultiplizieren, faktorisieren und binomische Formeln nutzen
- mit quadratischen Funktionen in unterschiedlichen Termdarstellungen arbeiten
- quadratische Gleichungen lösen
|
- Modellieren
- Problemlösen
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Darstellungsformen
|
- Betrachtung von Kurven (Brückenbögen etc.) und funktionalen Zusammenhängen (Bremsweg)
- Darstellungswechsel
- Scheitelpunktform; Parameterveränderungen ("Verschiebungen im KOS")
- quadratische Ergänzung und p/q-Formel
|
- Verkehr (LP)
- Ernährung (LP)
|
|
Zinseszins und exponentielles Wachstum
- Zinseszinsrechnung durchführen
- Gleichungen der Form bx = c durch Probieren lösen
- exponentielles Wachstum begrifflich abgrenzen und für Berechnungen nutzen
|
- Modellieren
- Kommunizieren: Informationen entnehmen
- Kommunizieren: Recherchieren
- Werkzeuge: Tabellenkalkulation
|
- Wiederholung der Zinsrechnung mit Wachstumsfaktor aus Jahrgangsstufe 8
- besondere Sensibilisierung für die Überschuldungsproblematik
- Umkehrbetrachtungen exemplarisch durchführen
|
- Kredite/Überschuldung (LP)
- Altersvorsorge/Kaufkraft(-verlust) (LP)
- Mathematik in verschiedenen Ausbildungsberufen (Handel/Dienstleistungen) (BO)
|
2.2 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung
Verbindliche Absprachen
- Bis zur Jahrgangsstufe 7 werden 6 Klassenarbeiten pro Schuljahr geschrieben. Bedingt durch Berufsorientierungsmaßnahmen, Vergleichsarbeiten und zentrale Prüfungen wird diese Anzahl ab Jahrgangsstufe 8 reduziert.
- Alle Schülerinnen und Schüler führen ein Arbeitsheft bzw. eine Mappe. Diese Mappe wird eingesammelt und mit einer Note im Rahmen der sonstigen Mitarbeit bewertet.
- Die Schüler erhalten nach jedem Unterrichtsvorhaben mindestens eine Note für ihre sonstige Mitarbeit im vergangenen Unterricht.
- Die Gesamtnote wird aus den Bereichen "Sonstige Mitarbeit" und "Schriftliche Arbeiten" gebildet, wobei die "Sonstige Mitarbeit" bis zur Jahrgangsstufe 8 stärker berücksichtigt wird. Ab der Jahrgangsstufe 9 erfolgt eine Gleichgewichtung der beiden Bereiche und die schriftlichen Arbeiten werden im ZP 10 - Format abgefasst. Eine schriftliche Arbeit pro Schuljahr wird durch eine individuell bewertbare Leistungsform (Teilaspekt der Praktikumsmappe, Portfolio, Ausstellung, ...) ersetzt.
2.3 Lehr- und Lernmittel
Weiterführende
Links:
3. Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen
3.1 Förderung der Sprache im Mathematikunterricht
Bezugnehmend auf den hohen Migrationsanteil der Lise-Meitner-Hauptschule wurde der Schulprogrammschwerpunkt "sprachsensibler Fachuntericht" von allen Kolleginnen und Kollegen der Schule an einem schulinternen Fortbildungstag bearbeitet. Nach einer gemeinsamen Problemerörterung wurden in den Fachgruppen fachbezogene "Glossare" erarbeitet, die für den jeweiligen Fachunterricht bedeutungsvoll sind und deren Verständnis und Gebrauch den Schülerinnen und Schülern näher gebracht werden soll. Neben den für die prozessbezogenen Kompetenzen "Argumentieren" und "Kommunizieren" notwendigen Verwendung eines fachbezogenen Vokabulars ist es unerlässlich im Rahmen sprachsensiblen Fachunterrichts Schwierigkeiten im Umgang mit Komposita, Adjektiven sowie Passiv- und Aktivkonstruktionen zu beachten (in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Fachkonferenz).
3.2 Fortbildungskonzept
Jedes Jahr sind Fortbildungen geplant, an denen auch Personen aus den größeren Partnerbetrieben teilnehmen, die den Schülerinnen und Schülern Praktikumsplätze zur Verfügung stellen. Dadurch sollen die Möglichkeiten, mathematische Aufgaben aus der realen Umgebungswelt in den Unterricht aufzunehmen, verstärkt werden.
Um die Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer in der Nutzung neuer Medien (Tabellenkalkulation, Geometriesoftware, Funktionenplotter ... ) zu stärken, sind auch Fortbildungen in diesem Bereich geplant, die mit dem ortsansässigen Kompetenzteam vorbereitet werden.

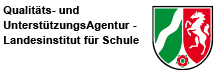
 Kontakt
Kontakt